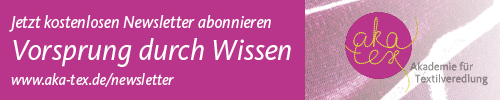Hersteller von Workwear präsentierten beim Nachhaltigkeitstag mit dem Titel GREEN.WORK.WEAR. am 9. Oktober bei Gastgeber Antholzer in München konkrete Lösungen für faire Lieferketten, langlebige Arbeitskleidung und gesetzeskonforme Beschaffung. Antholzer ist ein Großhandelsunternehmen für Arbeits- und Teamkleidung. Beim Branchentreffen waren die Marken und Textilhersteller Hakro, Blåkläder, Haix, Weitblick, Kübler Workwear, Eterna und Turns.
Wie gelingt nachhaltige Berufsbekleidung im Spannungsfeld von Lieferkettengesetz, EU-Textilstrategie und Kreislaufwirtschaft? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Nachhaltigkeitstags von Antholzer. Das Unternehmen hatte Entscheider aus Einkauf, Nachhaltigkeit und Facility Management im historischen Eisernen Haus des Schlosses Nymphenburg zusammenbrachte.
Geschäftsführer Stefan Antholzer eröffnete den Tag mit einem klaren Appell: „Heute ist Nachhaltigkeit noch Kür – bald wird sie Pflicht. Wir verstehen uns als Mittler zwischen Produzenten und Kunden, um das Thema frühzeitig in die Praxis zu bringen.
Gesetzliche Pflicht wird zur Marktchance
Den inhaltlichen Auftakt machte Simona Rutenfranz vom German Fashion Verband. Sie ordnete die aktuellen Regulierungen von LkSG und CS3D über CSRD bis zur EU-Textilstrategie in ein Gesamtbild ein und forderte: „Zertifikate helfen, ersetzen aber nicht die eigene Verantwortung. Nachhaltigkeit ist kein Trendwort, sondern eine unternehmerische Haltung.“
Mit ihrem Modell des „Sustainability Tree“ zeigte Rutenfranz, wie Unternehmen über Wesentlichkeitsanalysen und OECD-konforme Sorgfaltspflichten zu belastbaren Entscheidungen kommen können.
 Kreislaufwirtschaft und CO₂-Bilanz im Fokus
Kreislaufwirtschaft und CO₂-Bilanz im Fokus
Die Dringlichkeit des Themas zeigte sich deutlich: Europaweit fallen jährlich 12,6 Mio. Tonnen Alttextilien an – weniger als ein Prozent davon wird zu neuer Kleidung verarbeitet. Mehrere Anbieter präsentierten beim Nachhaltigkeitstag Lösungsansätze, wie sich textile Wertschöpfungsketten nachhaltig schließen lassen.
Hakro setzt auf geschlossenen Produktkreislauf und digitale Nachverfolgbarkeit
Mit einem praxiserprobten Rücknahmesystem zeigte Hakro, wie Berufsbekleidung heute bereits kreislauffähig gestaltet werden kann. Das System ermöglicht Unternehmen, ausgetragene Unternehmensbekleidung kontrolliert zurückzugeben, sortenrein zu erfassen und die Materialien anschließend in definierte Verwertungs- und Recyclingpfade zu überführen.
Über eine digitale Plattform werden dabei Einspeisemengen, Recyclingquoten und Verwertungswege dokumentiert und für das Nachhaltigkeits- und CSRD-Reporting bereitgestellt. Damit erfüllt HAKRO nicht nur kommende gesetzliche Anforderungen, sondern liefert Kunden zugleich belastbare Daten für ihre Scope-3-Emissionen und ESG-Nachweise.
„Kreislaufwirtschaft ist das Gebot der Stunde“, betonte Jürgen Pruy, Bereichsleiter Vertrieb und Partnerschaften bei Hakro. „Wir übernehmen Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte, von der Faser bis zur Wiederverwertung. Unser Ziel ist, gemeinsam mit Partnern geschlossene Stoffkreisläufe zu etablieren, die ökologisch wie ökonomisch tragfähig sind.“
Blåkläder forciert Langlebigkeit statt Siegelvielfalt
Das schwedische Familienunternehmen Blåkläder machte deutlich, dass wahre Nachhaltigkeit mit der Lebensdauer der Produkte beginnt. Statt sich auf die wachsende Zahl an Zertifikaten zu verlassen, setzt Blåkläder auf eigene Fertigungen, langjährige Partnerschaften und konsequente Qualitätskontrolle in allen Produktionsstufen.
„Wir sagen Nein, damit unsere Kunden es nicht müssen“, erklärte Thomas Weber, Vertriebsleiter Deutschland. „Langlebigkeit und Fairness in der Lieferkette sind für uns keine Schlagworte, sondern gelebte Praxis.“ Sein Beitrag zeigte, wie komplex nachhaltiger Einkauf im internationalen Kontext ist und dass Transparenz und Vertrauen über reine Siegelorientierung hinausgehen müssen.
Vergleichbare CO₂-Bilanzen entlang der Lieferkette von Haix
Haix legte den Fokus auf CO₂-Transparenz und die Herausforderung, Emissionen entlang der gesamten Lieferkette messbar zu machen. Nachhaltigkeitsmanager Florian Schmidt zeigte, wie schwierig die Ökobilanzierung von Materialien wie Rinderleder gegenüber veganem Leder ist. Dabei unterstrich er, dass nicht nur die Herkunft der Materialien, sondern auch deren Lebensdauer entscheidend für die Umweltbewertung ist: „Es macht einen großen Unterschied, ob ein Schuh ein Jahr oder zehn Jahre hält. Ökobilanzielle Kennzahlen sollten daher auf die konkrete Haltbarkeit des betrachteten Produktes bezogen sein, um die tatsächliche Umweltauswirkung bewerten zu können.“
Weitblick senkt mit „Design für Dauer“ die Kosten und Emissionen
Weitblick demonstrierte, wie durch „Design für Dauer“ sowohl Ressourcen geschont als auch die Total Cost of Ownership (TCO) verbessert werden können. Ein Produktvergleich nach EN ISO 15797 zeigte deutliche Qualitätsunterschiede nach realistischen Waschzyklen.
„Wer Wert auf ein gutes Erscheinungsbild legt, sollte Arbeitskleidung beschaffen, die auch nach vielen Waschzyklen noch überzeugt“, erklärte Isabelle Ilori-King. „Langlebigkeit beginnt mit Materialauswahl, Design und Pflegeanleitung – und endet mit einer verlängerten Nutzung im Arbeitsalltag.“
Faire Löhne und soziale Verantwortung bei Kübler Workwear und Eterna
Neben ökologischen Themen stand auch die soziale Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. So stellte Kübler Workwear mit „Open Costing“ eine Methode vor, um existenzsichernde Löhne (Living Wages) direkt in Preisverhandlungen abzubilden. „Transparenz über Kosten verbindet wirtschaftliche Realität mit sozialer Verantwortung“, betonte Kerstin Janßen, Leiterin Produktion, Einkauf und Nachhaltigkeit bei Kübler.
Auch Eterna zeigte, dass Nachhaltigkeit im Detail steckt: 600 Kilometer Verpackungsband wurden eingespart, Knöpfe bestehen inzwischen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester. „Nachhaltigkeit war für uns nie ein Modethema“, sagte dazu CSR-Manager Thomas Sterl.
Start-up Turns: Zirkularität wird zur Pflicht
Besonders visionär präsentierte sich das Start-up Turns, das die Transformation von der linearen zur zirkulären Textilwirtschaft technisch und digital abbildet. Über das Turns B2B-Portal lassen sich Alttextilien anmelden, Recyclingwege lückenlos nachverfolgen und Reportingdaten für CSRD/Scope 3 generieren.
Seit dem 1. Januar 2025 gilt die Pflicht zur getrennten Textilsammlung, die neue EU-Abfallrahmenrichtlinie bereitet zudem die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) bis 2028 vor. Turns zeigt mit seinen Faser-zu-Faser-Recyclingklassen (A–D), wie sich Textilien qualitätsgestuft wiederverwerten lassen – und wie Design-for-Recycling bereits in der Produktentwicklung beginnen muss.
„Textilrecycling ist möglich – wir können uns lineares Wirtschaften nicht mehr leisten. Unsere Plattform schafft die digitale Brücke zwischen Produzent, Nutzer und Recycler, transparent, rückverfolgbar und EU-konform“, so Katja Wagner
Fazit: Nachhaltigkeit wird zur Pflichtaufgabe
Die Veranstaltung GREEN.WORK.WEAR. machte deutlich, worauf Einkäufer künftig achten müssen:
1. Rücknahme & Datenfluss: Vertraglich geregelte End-of-Life-Lösungen mit Mengen- und Recyclingdaten für CSRD/Scope-3.
2. Langlebigkeit & Normpraxis: Qualitätsstandards (z. B. EN ISO 15797) als Zuschlagskriterium zur TCO-Optimierung.
3. CO₂-Transparenz: Product Carbon Footprints und klare Lieferanten-KPIs.
„Nachhaltigkeit ist kein Wettbewerbsvorteil mehr – sie wird zur Eintrittskarte in den Markt“, fasste Stefan Antholzer zusammen.
Sie möchten erfahren, wie Ihr Unternehmen die Arbeits- und Teambekleidung nachhaltig ausrichten kann oder Sie haben Interesse am nächsten Event teilzunehmen? Dann melden Sie sich gerne bei per Mail bei nachhaltigkeit@antholzer.de.
Anzeige
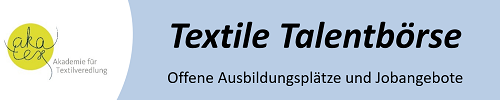
 Dies eröffnet Marken, Agenturen, Designern und Druckereien neue Möglichkeiten. MAGIC INK wird wie herkömmliche, wasserbasierte Siebdruckfarbe aufgetragen – ohne spezielle Vorbehandlung oder Spezialausrüstung. Temporäre Kampagnen- oder Eventbotschaften lassen sich mit permanentem Branding kombinieren. Wenn die Botschaften nicht mehr aktuell sind, werden sie herausgewaschen. Die gereinigten Kleidungsstücke können privat oder für mehrere Events wiederverwendet werden. Die verlängerte Nutzungsdauer von Textilien reduziert den Wasserverbrauch und die CO₂-Emissionen im Vergleich zu einmal getragener Kleidung um bis zu 95 % und senkt gleichzeitig die Kosten.
Dies eröffnet Marken, Agenturen, Designern und Druckereien neue Möglichkeiten. MAGIC INK wird wie herkömmliche, wasserbasierte Siebdruckfarbe aufgetragen – ohne spezielle Vorbehandlung oder Spezialausrüstung. Temporäre Kampagnen- oder Eventbotschaften lassen sich mit permanentem Branding kombinieren. Wenn die Botschaften nicht mehr aktuell sind, werden sie herausgewaschen. Die gereinigten Kleidungsstücke können privat oder für mehrere Events wiederverwendet werden. Die verlängerte Nutzungsdauer von Textilien reduziert den Wasserverbrauch und die CO₂-Emissionen im Vergleich zu einmal getragener Kleidung um bis zu 95 % und senkt gleichzeitig die Kosten.

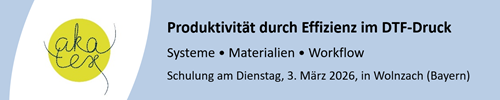

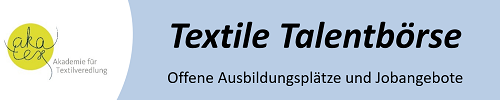

 Nachhaltigkeit ist längst kein Randthema mehr, sondern einer der zentralen Treiber der Werbemittelbranche. Immer mehr Unternehmen legen Wert auf transparente Lieferketten, kurze Transportwege und glaubwürdige Herkunft. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Design, Qualität und Flexibilität.
Nachhaltigkeit ist längst kein Randthema mehr, sondern einer der zentralen Treiber der Werbemittelbranche. Immer mehr Unternehmen legen Wert auf transparente Lieferketten, kurze Transportwege und glaubwürdige Herkunft. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Design, Qualität und Flexibilität.  Das Gewebe ist nach GOTS oder GRS zertifiziert und steht für umweltfreundliche, ressourcenschonende und sozial verantwortliche Produktion. Mit dieser Verbindung aus Regionalität, Automatisierung und Nachhaltigkeit setzt SETEX ein starkes Zeichen für die Zukunft der europäischen Werbemittelproduktion.
Das Gewebe ist nach GOTS oder GRS zertifiziert und steht für umweltfreundliche, ressourcenschonende und sozial verantwortliche Produktion. Mit dieser Verbindung aus Regionalität, Automatisierung und Nachhaltigkeit setzt SETEX ein starkes Zeichen für die Zukunft der europäischen Werbemittelproduktion.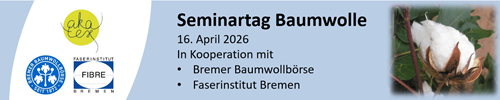

 Kreislaufwirtschaft und CO₂-Bilanz im Fokus
Kreislaufwirtschaft und CO₂-Bilanz im Fokus